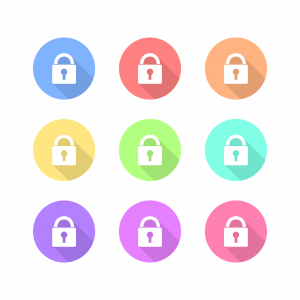Die Corona-Pandemie hat wissenschaftliche Erkenntnisse, Forschungen und Ergebnisse flächendeckend in unsere Wohnzimmer gebracht. Wenn Fachbegriffe zuvor Expert:innen vorbehalten waren, wurde man spätestens im Frühling 2020 mit wissenschaftlichen Begriffen überrollt, denn plötzlich hieß es auf allen Plattformen: r-Wert, Basisreproduktionszahl, Triage, Superspreading, etc.
Die Art und Weise, wie Sprache zur Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen verwendet wird, ist hier besonders wichtig. Klarheit und Transparenz sollten oberste Priorität haben, um das allgemeine Verständnis zu gewährleisten. Das ist allerdings insbesondere in Hinblick auf die Thematik nicht immer leicht umsetzbar. Auch das enorme Aufkommen von Fake News in Bezug auf die Pandemie hat gezeigt: Ein evidenzbasierter, gesamtgesellschaftlicher Diskurs ist unerlässlich.
Was also tun, um gesellschaftstauglichen Wissenschaftsjournalismus zu betreiben? Wie kann man Wissenschaft kommunizieren und dabei nicht nur Expert:innen, sondern die breite Masse erreichen? Wie lässt sich ein Zugang legen für Menschen, die aufgrund ihrer (sprachlichen) Voraussetzungen aus dem allgemeinen Wissenschaftsdiskurs exkludiert werden?
Wissenschaft für alle
Das Karlsruher Institut für Technologie (Bereich Wissenschaftskommunikation) hat zusammen mit „Wissenschaft im Dialog“ von 2017 bis 2020 im Projekt „Wissenschaft für alle: Wie kann Wissenschaftskommunikation mit bisher nicht erreichten Zielgruppen gelingen?“ (gefördert von der Robert Bosch Stiftung) systematisch untersucht, welche Bevölkerungsgruppen bisher nicht oder kaum von Wissenschaftskommunikation erreicht werden, die Gründe dafür und zukünftige Handlungsempfehlungen für die Wissenschaft ermittelt.
Die 31 identifizierten Exklusionsfaktoren werden jeweils drei übergreifenden Kategorien zugeschrieben: 1) Individuelle Faktoren, 2) Soziale Faktoren und 3) Strukturelle Bedingungen. Diese sind aber nicht trennscharf zu betrachten, oftmals überlappen sie sich oder verstärken einander. Ein Zusammenspiel verschiedener Exklusionsfaktoren und deren unzureichende Berücksichtigung in der Wissenschaftskommunikation führt letztlich zum Ausschluss aus dem Dialog.
Die allgemeine Botschaft des Projekts ist klar: Wissenschaftsorganisationen müssen ihre Kommunikationsstrategien und -maßnahmen kritisch hinterfragen und diese diverser und inklusiver gestalten. Um diese Forderung zu konkretisieren, wurden im weiteren Verlauf des Projekts drei Gruppen ausgewählt, die von klassischen Formaten der Wissenschaftskommunikation oft nicht erreicht oder ausgeschlossen werden: 1) sozial benachteiligte Menschen in marginalisierten Stadtteilen, 2) Berufsschülerinnen und Berufsschüler, 3) muslimische Jugendliche mit Migrationshintergrund. In Interviews und Fokusgruppen mit Vertreter:innen der Gruppen wurden deren Bedürfnisse ausgehandelt und neue Formate für gelingende Wissenschaftskommunikation entwickelt und erprobt. Eines der Projekte war ein Science- & Poetry-Slam in Berlin-Neukölln.
Im Karlsruher Institut für Technologie ist ebenfalls das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) zu Hause. Die Zielsetzung des NaWiks ist es, Akteur:innen und Multiplikator:innen aus verschiedensten Bereichen die Grundlagen guter Wissenschaftskommunikation zu vermitteln. Zur Motivation heißt es auf der Website des Instituts:
„Wissenschaft ist ein wichtiger Teil unserer Kultur und unerlässlich für die künftige Entwicklung der Gesellschaft. Wenn Wissenschaft viele Menschen erreichen soll, muss sie verständlich sein. Wir vermitteln in unseren Seminaren das Handwerkszeug und frische Konzepte, um Forschung besser kommunizieren zu können. Wir möchten den Teilnehmenden unserer Seminare zeigen, wie das Zusammenspiel zwischen Forschenden, professionellen Kommunikator:innen und Journalist:innen gelingt.“
(NaWik, „Über uns“)
Barrierefreie Kommunikation: Wie und für wen?
Wissenschaftskommunikation ist aber häufig Expertenkommunikation. Bürger und Bürgerinnen sind allerdings meist Laien und bei vulnerablen Gruppen kommen zusätzlich Aspekte hinzu, die das Verstehen von Informationen beeinträchtigen können. Ein Beispiel: Laut der Studie „Wissenschaftskommunikation barrierefrei“ hatten Gehörlose zu Beginn der Pandemie kaum bis gar keinen Zugriff auf verlässliche Informationen, da Gebärdensprachverdolmetschung in den Nachrichten oder bei Pressekonferenzen in Deutschland nicht zum Standard gehört. Der Zugriff auf Informationsangebote ist für diese Menschen ohne Hilfe also schlichtweg nicht möglich gewesen. Barrierefreie Kommunikation ist hier das Stichwort.
Die Studie weist zudem darauf hin, dass um mit Wissenschaftskommunikation alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen, diese die folgenden Kriterien erfüllen muss: Auffindbarkeit und Wahrnehmbarkeit, Verständlichkeit und Verknüpfungsfähigkeit. Schlussendlich müssen Informationen darüber hinaus akzeptabel sein, das bedeutet: Nicht übergriffig, asymmetrisch, unfreundlich oder von oben herab. Die Hauptzielgruppe barrierefreier Kommunikation sind Personen mit Behinderungen, doch – wie oben bereits anhand der Exklusionsfaktoren festgestellt – kann im Grunde jede Person auf Kommunikationsbarrieren in verschiedenen Ausprägungen treffen, beispielsweise, wenn Informationen auf einem Kanal vertrieben werden, den man nicht nutzt. Während fast 100 Prozent der Deutschen online sind, gilt dies nicht für die Gruppe der Senioren. Ab 74 Jahren geht die Nutzung drastisch zurück: Nur noch die Hälfte nutzt das Internet, davon viele sporadisch und nur auf einige wenige Plattformen beschränkt (vgl. ebd.).
Soziale Medien können ein wirksamer Kanal für die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte sein (siehe: Dossier-Beitrag „Wissenschaft & Social Media“). Aber nur dann, wenn die gewünschte Zielgruppe auch auf den jeweiligen Plattformen anzutreffen ist. Der in dem Projekt „Wissenschaft für alle“ ermittelte Exklusionsfaktor „Alter“ ist hier nicht zu vernachlässigen.
Doch auch Kinder und Jugendliche können explizit Exklusion aus dem öffentlichen Wissenschaftsdiskurs erfahren. Die Studie „Soziale Inklusion durch und in Wissenschaftskommunikation“ betrachtet die Situation von marginalisierten Kindern und Jugendlichen in Wien. Es wurde ermittelt, dass sich unterschiedliche Zugangsbarrieren in drei Hauptkategorien gliedern lassen: 1) Infrastruktur, 2) Bildung und Kompetenzen und 3) Akzeptanz. Die Forscher:innen legen einige Empfehlungen dar, wie Barrieren konkret überwunden werden können. Eine Auswahl an Beispielen: Der Zielgruppe muss die aktive gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden und sie muss ebenso als Zielgruppe wissenschaftlicher Kommunikation anerkannt und entsprechend adäquat adressiert werden. Wissenschaftliche Angebote müssen sichtbar und erreichbar sein. Im Idealfall wird die Zielgruppe zur Erarbeitung und Evaluierung neuer Formate und Angebote miteinbezogen und Alltagsrelevante Themen vermehrt in den Fokus gerückt. Auch die Sprache spielt hier im Sinne der Vermittlung und Übersetzung wissenschaftlicher Inhalte eine besondere Rolle.
Leichte oder Einfache Sprache?
Ein Teilaspekt der barrierefreien Kommunikation ist die Leichte Sprache. Insbesondere in den letzten Jahren ist das Konzept der Leichten Sprache immer mehr zum Gegenstand geworden – mittlerweile hat jede Bundesbehörde auf ihrer Startseite ein Piktogramm zum Angebot in Leichter Sprache verlinkt. Seit 2006 gibt es das Netzwerk Leichte Sprache in Deutschland.
Christiane Maaß ist Professorin für Medienlinguistik an der Universität Hildesheim und leitet die 2014 gegründete Forschungsstelle Leichte Sprache am Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation der Universität Hildesheim. Sie bricht den Begriff Leichte Sprache in ihrem Beitrag „Gerade in der Medizin- und Gesundheitskommunikation brauchen wir Verständlichkeit“ wie folgt herunter: „Leichte Sprache ist die Ausprägung des Deutschen, die in maximaler Weise Verständlichkeit herstellt“.
Neben der Leichten gibt es außerdem die Einfache Sprache: Diese wird in der Experten-Laien-Kommunikation genutzt, also dann, wenn es darum geht, fachliche oder wissenschaftliche Themen verständlich darzustellen. Christiane Maaß und ihr Team haben bei der Forschungsstelle Leichte Sprache allerdings eine dritte Zwischenstufe etabliert: Die Leichte Sprache Plus. Sie ist verständlicher als die Einfache Sprache, hat aber bestimmte auffällige Eigenschaften der Leichten Sprache nicht. Doch was macht eine generell verständliche Sprache aus?
„Zum einen Prinzipien, die einem der Menschenverstand sagt: Ich mach die Sätze nicht so lang und die Wörter nicht so schwierig. Ich bringe Erklärungen und Bilder. Allerdings gibt es unterschiedliche Personenkreise mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Es gibt Menschen, die nicht hören können, die eine geistige Behinderung oder Lernschwierigkeiten haben oder keine Muttersprachler*innen sind. Manche Menschen leiden unter Demenz oder Aphasie, also einem Verlust des Sprachvermögens. Die Frage ist: Gibt es Eigenschaften für Texte, die für alle Gruppen zuträglich sind? Das wollen wir herausfinden.“ –
„Das neue Corona-Virus ist sehr ansteckend. Und es kann eine Krankheit auslösen: COVID-19. Weil das Virus neu ist, haben viele Menschen noch keine Abwehrkräfte gegen COVID-19. Deshalb werden viele Menschen krank.“ – Zitat aus: Zusammen gegen Corona
(Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit – „Warum ist das neue Corona-Virus so gefährlich?“)
Und das ist – insbesondere mit Blick auf die Pandemie, aber auch übergreifend – hierzulande sehr wichtig: Verschiedene Studien belegen, dass mehr als 54 % der deutschen Bevölkerung gesundheitsrelevante Informationen nicht verstehen. Ebenfalls an der Universität Hildesheim wurde im Frühjahr 2020 die Initiative „Barrierefreie Kommunikation und Corona“ ins Leben gerufen. Hier geht es insbesondere um die Übersetzung relevanter Informationen rund um das Coronavirus. Gerade Krisenzeiten bedürfen einer speziellen Kommunikationsstrategie. Das sagt auch Dr. Marion Dreyer, Leiterin des Projekts RiCoRT: „Grundsätzlich ist es wichtig, dass in Krisenzeiten schnell, transparent, verständlich, koordiniert und konsistent kommuniziert wird.“. Im Projekt RiCoRT wurden Ziel- und bedarfsgerechte Kommunikationsmaßnahmen ermittelt und mit Expert:innen für Gesundheit und Kommunikation diskutiert.
Wissenschaft & Partizipation
Während Wissenschaftskommunikation lange ausschließlich dem Austausch Forschender untereinander diente, wurde spätestens in den 1980er Jahren das allgemeingesellschaftliche Verständnis wissenschaftlicher Inhalte zum Thema gemacht. Seit der Jahrtausendwende geht es allerdings nun nicht mehr nur um das reine Transportieren von Wissen. Der Anspruch an gute Wissenschaftskommunikation – die alle Bevölkerungsgruppen erreicht – hat sich vielmehr um die Aspekte Partizipation und Dialog erweitert. Besonders digitale Plattformen und Netzwerke bieten mögliche Kanäle, diese Art der Wissenschaftskommunikation auszuspielen und mit einer breiten Masse in Kontakt zu treten. Eine solche wissenschaftliche Kommunikation gilt als Goldstandard, denn sie „orientiere [..] sich stärker an den Kompetenzen, Bedürfnissen und Kommunikationsroutinen einer mündigen Bevölkerung“, so Niels Mede in „Partizipative Wissenschaftskommunikation: Promises and Pitfalls„.
Folgende Potenziale ergeben sich durch partizipative und dialogische Formate:
- die Ermöglichung von Bürgerbeteiligung,
- Reduzierung von Informations- und Kommunikationshürden zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit,
- Einblicke in den Prozess wissenschaftlicher Forschung,
- Mediale Interaktionsangebote,
- die Berücksichtigung wissenschaftskritischer Vorbehalte,
- das Erlauben nicht-rationaler, subjektiver, narrativer und emotionalisierender Kommunikation.
Doch trotz ihrer Vorteile haben partizipative Formate laut Niels Mede auch Limitationen, denn: Oftmals erreichen dialogartige Ansätze ein Publikum, welches ohnehin bereits wissenschaftsaffin ist. Auch hier müssen die Hürden und Barrieren für Menschen mit Einschränkungen besonders berücksichtigt werden. Will man alle Menschen in den öffentlichen Diskurs miteinschließen und diese an solchen Projekten teilhaben lassen, muss man gewährleisten, dass diese auch den erforderlichen Zugang erhalten – zugeschnitten auf ihre jeweiligen Voraussetzungen. Zudem sind Beteiligungs- und dialogorientierte Formate bisher hinsichtlich ihres möglichen Erfolgs wenig untersucht und daher (noch) nicht empirisch gestützt (vgl. ebd.).
Wissenschaft & Inklusion – kann das gelingen?
Aus Sicht der Wissenschaft birgt die Aufgabe der barrierefreien Kommunikation also viele Herausforderungen – aber auch Möglichkeiten. Es wird keine „One size fits all“-Lösung geben. Dafür sind die Bedürfnisse und Voraussetzungen der Gesellschaft zu individuell. Definitiv gibt es aber Lösungen, die zumindest eine bestimmte Zielgruppe in den Wissenschaftsdiskurs inkludieren können. Nutzt man die gegebenen Ressourcen und Kanäle, kann es gelingen, Personen zu erreichen, die sonst durch die herkömmliche Kommunikation nicht erreicht werden würden.
Ein positives Beispiel ist die zielgerichtete Nutzung von Social-Media-Kanälen: Wissenschaftler:innen erhalten auf den digitalen Plattformen die Möglichkeit, mit einem Publikum in Kontakt zu treten, welches ihnen eventuell normalerweise als Rezipierende verborgen geblieben wäre. Auch die Nutzung Leichter oder Einfacher Sprache ist bei der Wissenschaftskommunikation von besonderer Relevanz. Die in diesem Beitrag aufgeführten Beispiele zeigen, wie unerlässlich eine einfache und transparente Sprache ist, die alle erreicht. Besonders dann, wenn es um Informationen geht, die den eigenen Alltag bestimmen.
Relevant ist aber auch, die jeweiligen Zielgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse überhaupt als solche wahrzunehmen und anzuerkennen. Das gilt für die Wissenschaft ebenso wie für die Medien, die als Kanäle der Informationsverbreitung dienen. Wenn man die gesamte Gesellschaft erreichen will, muss man ihre Heterogenität berücksichtigen und sich fragen: Wer ist die Zielgruppe, die wir erreichen wollen und was macht diese aus? Was sind ihre Bedürfnisse und Anforderungen? Und wie – auf welchem Weg, mit welcher Ansprache – kann diese Zielgruppe optimal erreicht werden?